
Stapler und StVO
Übersicht der rechtlichen Grundlagen
Stapler und Straßenverkehrsrecht
-
Wann unterliegt ein privates Betriebsgelände dem Straßenverkehrsrecht?
-
Welche Maßnahmen müssen bei den Staplern getroffen werden?
-
Welche Konsequenzen hat dies für die Staplerfahrer?
-
Was können wir für Sie tun?
Wann unterliegt ein privates Betriebsgelände dem Straßenverkehrsrecht?
Um es vorweg zu nehmen: Ist die Nutzung der Verkehrsflächen für mehr als nur einen eindeutig beschränkten Personenkreis möglich, handelt es sich um „öffentlichen Verkehrsraum“.
Die DGUV schreibt in der Begriffsbestimmung folgendes:
Definitionen und Begriffsbestimmungen zum Arbeitsgebiet Flurförderzeuge "Öffentlicher Verkehrsraum"
Öffentlicher Verkehrsraum sind alle Flächen, die der Allgemeinheit wegerechtlich (Widmung) oder tatsächlich (faktisch) zu Verkehrszwecken offen stehen, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen (vgl. Hentschel, Straßenverkehrsrecht, 40. Auflage 2009, Paragraph 1 StVO, Rdnr. 13).
Wegerechtlich öffentlicher Verkehrsraum ist eine für den Verkehr nach den Straßengesetzen des Bundes (Paragraph 2 FernStrG) oder der Länder (z.B. Paragraph 3 BlnStrG) gewidmete Verkehrsfläche. Die Widmung erfolgt in der Regel durch Verwaltungsakt (vgl. Schurig, StVO, 13. Auflage 2009, Paragraph 1 StVO, Anm. 2.1).
Tatsächlich (faktisch) öffentlicher Verkehrsraum ist eine Verkehrsfläche im privaten oder öffentlichen Eigentum (zivilrechtlich Privatgelände), die durch die Allgemeinheit mit ausdrücklicher oder stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten tatsächlich benutzt (praktisch privatrechtliche Widmung) wird (vgl. Schurig, StVO, 13. Auflage 2009, Paragraph 1 StVO, Anm. 2.1).
Da es auf Privatgelände nicht zu vorsorglichen Kontrollen durch die Staatsorgane kommt, ist es vielen Betreibern nicht bewusst, dass ihr Betriebsgelände rechtlich öffentlich ist.
Welche Maßnahmen müssen bei den Staplern getroffen werden?
Wer am Straßenverkehr teilnehmen möchte, muss zunächst das Straßenverkehrsgesetz (StVG) beachten. Dort heißt es in § 1 u. a.:
- 1 Zulassung (1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden sollen, müssen von der zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde) zum Verkehr zugelassen sein. (2) Als Kraftfahrzeug im Sinne dieses Gesetzes gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein.
Diese Bestimmung gilt somit auch für Stapler, wenn diese im öffentlichen Verkehrsbereich eingesetzt werden. Das Zulassungsverfahren selbst ist in der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) geregelt.
Welche Konsequenzen hat dies für die Staplerfahrer?
Staplerfahrer benötigen neben dem „Staplerschein“ auch die Fahrerlaubnis Klasse L. Jeder der einen Führerschein besitzt, sollte über die Fahrerlaubnis Klasse L verfügen.
Was können wir für Sie tun?
In Kooperation mit der DEKRA erstellen wir Vollgutachten für Ihre Stapler. In wenigen Fällen sind bauliche Veränderungen am Gerät nötig, die wir gern vornehmen. Mit dem Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis erhalten Sie bei Ihrer Zulassungsstelle die Genehmigung, den Stapler auf Ihrem privaten, aber rechtlich öffentlichen Grundstück zu betreiben. Darüber hinaus ist die Nutzung des gesamten öffentlichen Grunds unter Einhaltung der StVO möglich. Lediglich am Güterverkehr dürfen Ihre Stapler nicht teilnehmen, da diese steuerfrei genehmigt wurden.
Wir kümmern uns um Ihre Stapler, damit Sie rechtlich und versicherungstechnisch sicher fahren. Einmalige Kosten dafür liegen unter 500,- Euro. Folgekosten sind nicht zu erwarten.
Da dies ein kompliziertes Thema, mit widersprüchlichen Meinungen ist, stellen Sie ruhig Ihre Fragen persönlich:
Gesundheit
Staplerfahrer sind verschiedenen Belastungen ausgesetzt.
Der Gabelstaplerfahrer hat in den meisten Fällen mit schweren Lasten zu tun. Das erfordert die richtige Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Sicherheitshelm). Oft werden Gabelstapler in der Industrie eingesetzt. Dort kann es sehr laut sein. Der Stapler an sich kann auch sehr viel Krach verursachen (Dieselgabelstapler). Also ist eventuell ein Gehörschutz notwendig. Gabelstaplerfahrer sitzen oft sehr lange in einer Position. Dieser Bewegungsmangel sorgt unter anderem für Bandscheibenprobleme. Auch die Vibrationen die durch den Fahrbetrieb entstehen, sind gefährlich für die Wirbelsäule. Regelmäßiges Rückwärtsfahren ist besonders gefährlich, da die Wirbelsäule beim Zurückschauen verdreht wird.
Arbeitsende
Wenn Sie den Gabelstapler verlassen, müssen Sie das Gerät sichern. Dazu gehören folgende Punkte:
Nur auf geeignetem Untergrund abstellen und keine sicherheitstechnischen Einrichtungen oder Fahrwege versperren.
Lastaufnahmemittel in die tiefste Stellung ablassen und den Baum nach vorn neigen.
Alle Steuereinrichtungen auf Null stellen.
Mit Feststellbremse und gegebenenfalls Unterlegkeile gegen Wegrollen sichern.
Bei Dunkelheit den Stapler beleuchten.
Schlüssel abziehen und mitnehmen, um Benutzung durch Unbefugte zu verhindern.
Sondereinsätze
Es gibt Sondereinsätze die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung des Herstellers entsprechen. Diese wurden von den Berufsgenossenschaften geregelt. Solche Sondereinsätze sind das Ziehen von Anhängern, Mitfahren von Personen, Hochfahren von Personen, Zwillingsarbeit und das Verschieben von Schienenfahrzeugen.
Gabelstapler dürfen Anhänger ziehen, sofern alle Vorschriften für den Betrieb von Gabelstaplern eingehalten werden. Gabelstapler können im Allgemeinen so viel ziehen, wie sie heben können.
Sollte ein Gabelstapler mit einem zusätzlichen Fahrersitz oder Standplatz mit Festhalteeinrichtung und Rückhaltesystem ausgestattet sein, dürfen Personen die einen schriftlichen Mitfahrauftrag haben mitfahren.
Personen dürfen nur mit einer vorschriftsmäßigen Arbeitsbühne hochgefahren werden.
Zwillingsarbeiten sind Transportarbeiten mit zwei Staplern an einer Last. Ein Einweiser ist hier zwingend erforderlich.
Schienenfahrzeuge dürfen nur mit speziellen Vorrichtungen bewegt werden, da ein auf dem Gleis entlang fahren mit Staplern verboten ist.
Be- und Entladen von LKWs
Für das Be- und Entladen von LKWs sind Sie als Gabelstaplerfahrer und der LKW-Fahrer verantwortlich. Sie sollten sich vor der Arbeit unbedingt über den Ablauf verständigen.
Speziell ist darauf zu achten, dass die Feststellbremse des LKW angezogen ist. Das Fahrzeug bzw. der Anhänger muss standfest und gegen Wegrollen gesichert sein. Müssen Sie das Fahrzeug befahren, sind 2 Unterlegkeile vor die nicht gelenkten Räder zu legen.
Beim Befahren des Fahrzeuges ist besonders auf ausreichende Tragkraft der Ladefläche zu achten. Auch die Laderampe muss ausreichend tragfähig und gesichert sein.
Beim Laden von der Seite ist speziell darauf zu achten, dass die Lasten nicht mit Seilen oder Ketten hervorgezogen werden dürfen, da Gefahr von Peitschenschlägen besteht.
Für die Reihenfolge der Be- oder Entladung ist der LKW-Fahrer verantwortlich.


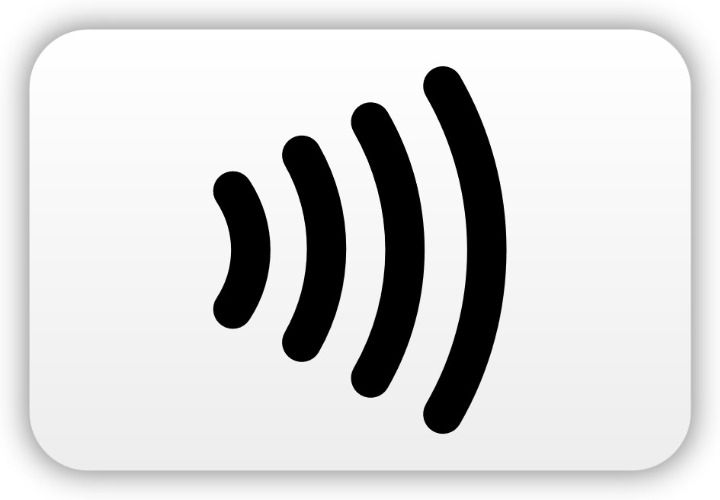



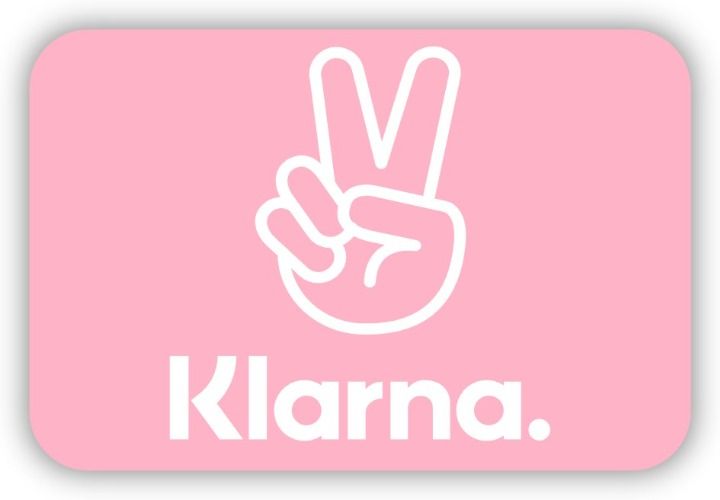




















 Der berufsgenossenschaftliche Grundsatz DGUV G 308-001 "Qualifizierung und Beauftragung der Fahrerinnen und Fahrer von Flurförderzeugen" gibt im Kapitel 5 die Mindestanforderungen an die Ausbilder vor:
Der berufsgenossenschaftliche Grundsatz DGUV G 308-001 "Qualifizierung und Beauftragung der Fahrerinnen und Fahrer von Flurförderzeugen" gibt im Kapitel 5 die Mindestanforderungen an die Ausbilder vor:
